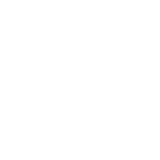In diesem Text erfahren Sie:
- Was ist Gendern?
- Wie funktioniert Gendern?
- Wie können Sie barrierefrei gendern?
- Was bedeutet diskriminierungsfreie Sprache?
- Inklusive Sprache – eine Frage der Haltung
Sprache formt unsere Realität und Wahrnehmung. Sie kann Menschen ein- oder ausschließen. In einer Demokratie sollen alle Personen teilhaben und miteinbezogen werden. Dazu gehören auch Menschen mit einer Behinderung sowie Menschen aller Geschlechter. Sprache kann sensibilisieren, indem sie inklusiv wird und alle anspricht. Inklusive Sprache fördert eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch wahrgenommen und respektiert fühlt. So spiegelt unsere Sprache Vielfalt wider.
Was ist Gendern?
Gendern bedeutet, alle Geschlechter und Geschlechteridentitäten sichtbar zu machen und gleich zu behandeln. Sprache bezieht sich daher nicht ausschließlich auf das generische Maskulinum, wie beispielsweise „der Bürger“. Neben Frauen sollen auch nicht-binäre, trans und intergeschlechtliche Personen einbezogen werden. Ziel ist es, durch eine respektvolle und inklusive Sprache Diskriminierung und Ausschluss zu vermeiden. In Luxemburg ist es jedoch wichtig, dass keine neuen grammatischen oder orthografischen Regeln aufgestellt werden. Die Möglichkeiten des Genderns sind vielfältig, aber es gibt keine allgemeingültigen Regeln.
Wie funktioniert Gendern?
Es existieren verschiedene Möglichkeiten, gendersensibel zu sprechen und zu schreiben. Es sind keine festen Regeln, sondern verschiedene Vorschläge. Je nach Situation und Zielgruppe kann man unterschiedliche Formen verwenden. Folgende Beispiele werden am häufigsten genutzt:
- Neutrale Formen: Lehrkräfte, Studierende, Personal, Leute, Menschen
- Doppelnennungen: Studentinnen und Studenten
- Gender-Sternchen, oder Asterisk: Student*innen
- Doppelpunkt: Student:innen
- Beim Sprechen macht man eine kurze Pause: Student – Pause – innen
- Binnen-I: StudentInnen.
Nicht jede Form des Genderns spricht alle Geschlechter an. Es gibt noch weitere Formen, die weniger oft verwendet werden.
Wie können Sie barrierefrei gendern?
Barrierefrei und gendern schließt sich gegenseitig nicht aus. Es gibt einige Aspekte, die beachtet werden müssen.
Screenreader-freundlich gendern
Viele blinde Menschen oder Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung nutzen einen Screenreader. Ein Screenreader liest Texte auf Webseiten laut vor. Je nach Screenreader kann sich die Sprachausgabe ändern.
Damit das gut funktioniert:
- Neutrale Wörter
- Doppelnennungen
- Gender-Sternchen wird vorgelesen als „Student-Stern-innen“. Bei manchen Screenreadern kann man einstellen, dass der Asterisk als kurze Pause vorgelesen wird.
- Doppelpunkt: manche Screenreader lesen den Doppelpunkt als Sprechpause, manche sprechen den Doppelpunkt als Satzzeichen aus. Viele blinde Menschen empfinden die Pause als zu lang. Je nach technischem Verständnis und Präferenz kann dies eingestellt werden. Allerdings sind Sonderzeichen für blinde Menschen generell nicht barrierearm. Am besten wäre es, ein allgemein gültiges Zeichen für das Gendern zu haben und kein Satzzeichen, welches bereits eine andere Nutzung hat.
Gendern in Leichter Sprache
Leichte Sprache soll einfach und gut lesbar sein. Gendern ist möglich, aber es gibt Regeln:
- Doppelnennung wird empfohlen, mit der männlichen Form zuerst: Studenten und Studentinnen
- Nachteil: Dadurch werden die Sätze länger.
- Neutrale Wörter sind oft besser: Leute, Team, Personal
- Gender-Sternchen: kann genutzt werden, wenn ein neutrales Wort zum Beispiel zu schwer zu verstehen ist, wie Mitarbeitende.
Was bedeutet diskriminierungsfreie Sprache?
Diskriminierungsfreie Sprache bedeutet, Sprache so zu nutzen, dass auf Benachteiligung und Stereotypen verzichtet wird. Es geht nicht nur darum, bestimmte Wörter zu vermeiden. Wichtig ist eine respektvolle und wertschätzende Haltung. Manchmal werden Wörter und Sätze benutzt, die unbewusst diskriminierend sind. Zum Beispiel gegenüber Menschen mit einer Behinderung. Dies nennt man Ableismus. Das bedeutet, ein Mensch wird abgewertet, weil er nicht dem Idealbild von Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Autonomiefähigkeit entspricht.
Im Zusammenhang mit einer Behinderung soll nicht über den Menschen gesprochen werden, sondern mit ihm. Im Zweifelsfall kann man in der direkten Kommunikation fragen, wie die Person genannt werden möchte und was sie als beleidigend empfindet.
- „Der/ die Behinderte“: dies reduziert die Person auf seine Merkmale, daher ist die bessere Formulierung: Mensch mit einer Behinderung.
- „An den Rollstuhl gefesselt“: stellt die Lebensrealität des Menschen als scheinbar weniger lebenswert dar. Eine gute Formulierung wäre: Eine Person, die einen Rollstuhl benutzt.
Es gibt viele weitere diskriminierende Aussagen, die anders formuliert werden können. In unseren Ressourcen finden Sie Listen und Glossare zu diskriminierenden und ableistischen Ausdrücken sowie Möglichkeiten, diese umzuformulieren.
Inklusive Sprache – eine Frage der Haltung
Inklusive Sprache ist eine Sprache, in der wir alle miteinbeziehen wollen. Das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, die Herkunft bzw. die Kultur und eine Behinderung sind dabei egal. In der Kommunikation mit anderen ist es von Bedeutung, sich Gedanken über die eigenen Worte zu machen und anderen Menschen respektvoll und wertschätzend zu begegnen.
Eine perfekte gendergerechte und diskriminierungsfreie Sprache gibt es nicht. Es geht darum, sich bewusst zu machen, mit wem wir gerade sprechen und was wichtig ist. Eine inklusive Sprache bringt viele Herausforderungen mit sich. Es gilt, darauf aufmerksam zu machen, indem wir sensibilisieren und informieren. Sprache ist stetig im Wandel. Indem wir sie aktiv mitgestalten, können wir das Leben vieler Menschen verbessern. So tragen wir dazu bei, eine inklusivere Gesellschaft zu fördern.