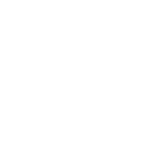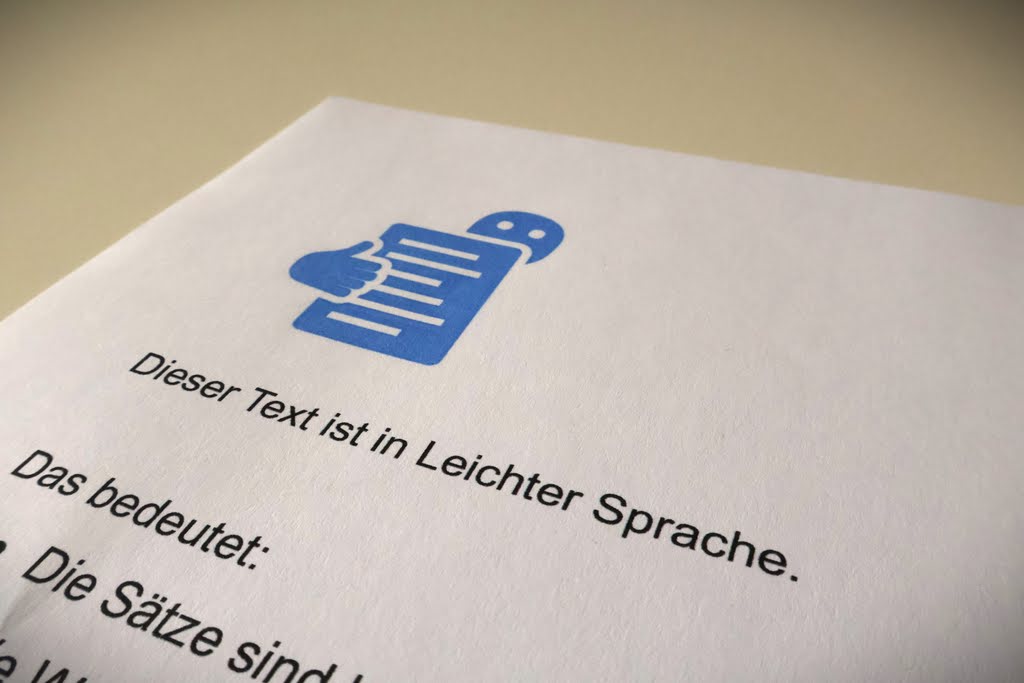In diesem Text erfahren Sie:
- Was ist Leichte Sprache?
- Welche Regeln gelten für Leichte Sprache?
- Wie werden Texte in Leichter Sprache erstellt?
Was ist Leichte Sprache?
Leichte Sprache ist eine stark vereinfachte Variante einer Sprache, die klaren Regeln folgt. Ziel ist es, Wortschatz, Grammatik und Inhalt so verständlich wie möglich zu gestalten.
Leichte Sprache wurde als Mittel zur kommunikativen Teilhabe geschaffen. Sie soll Menschen mit Lernschwierigkeiten die Teilhabe an Informationen ermöglichen.
Das Konzept der Leichten Sprache existiert für verschiedene Einzelsprachen. Neben der Leichten Sprache für den deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel „FALC“ (Facile à lire et à comprendre) für den französischsprachigen Raum und „Easy-to-Read“ für den englischsprachigen Raum.
Leichte Sprache ist keine natürliche Sprache, sondern eine künstlich geschaffene und stark regulierte Sprache. Sie folgt spezifischen Regeln, nach denen Informationen besser wahrnehmbar und leichter verständlich vermittelt werden können. Insbesondere die Interessensvertretung „Inclusion Europe“ hat die Entwicklung der Leichten Sprache innerhalb Europas maßgeblich vorangetrieben und Regeln für die Leichte Sprache entwickelt. Inclusion Europe setzt sich europaweit für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Seit dem Jahr 2014 wird das Konzept der Leichten Sprache auch sprachwissenschaftlich betrachtet. Inzwischen existieren verschiedene Regelwerke zur Leichten Sprache. In unseren Ressourcen finden Sie das Regelwerk von Inclusion Europe „Informationen für alle“. Für die deutsche Leichte Sprache gibt es außerdem die DIN-Norm DIN SPEC 33429: Empfehlungen für Leichte Sprache.
Welche Regeln gelten für Leichte Sprache?
Texte in Leichter Sprache sind so aufbereitet, dass die Leserinnen und Leser sie optimal wahrnehmen und verstehen können. Zunächst wird die Zielgruppe festgelegt und bestimmt, welche Informationen vermittelt werden sollen.
Texte in Leichter Sprache sind inhaltlich kürzer als standardsprachliche Texte. Denn: In einigen Fällen haben Menschen mit einer eingeschränkten Lesekompetenz gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung. Damit geht oftmals eine geringere Aufmerksamkeitsspanne einher. Deshalb findet beim Erstellen von Inhalten in Leichter Sprache eine Informationsauswahl statt. Ziel ist es, den Informationsgehalt und damit den Textumfang zu kürzen, damit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung den Text besser verarbeiten können.
Damit Texte in Leichter Sprache optimal verständlich sind, müssen sie besondere Eigenschaften in Bezug auf Sprache, Textaufbau und Layout aufweisen. Hier einige der wichtigsten Regeln. Das vollständige Regelwerk finden Sie in den empfohlenen Leitfäden in unseren Ressourcen.
Wortschatz
- Verwenden Sie einfache und leicht verständliche Wörter.
- Trennen Sie längere Wörter mit einem Bindestrich, um die Lesbarkeit zu verbessern.
- Schwierig: Patientenverfügung
Besser: Patienten-Verfügung
- Schwierig: Patientenverfügung
- Erklären Sie unbekannte Wörter oder Fachbegriffe innerhalb des Textes oder in einem Glossar.
- Verwenden Sie gleiche Wörter für gleiche Dinge.
- Verwenden Sie Beispiele, um Dinge zu erklären.
- Verzichten Sie auf Pronomen und wiederholen Sie stattdessen das konkrete Nomen. Richten Sie sich direkt an die Leserschaft.
- Schwierig: Die Ärztin untersucht die Patientin. Sie schreibt ihr ein Rezept.
Besser: Die Ärztin untersucht die Patientin. Die Ärztin schreibt ein Rezept für die Patientin.
- Schwierig: Die Ärztin untersucht die Patientin. Sie schreibt ihr ein Rezept.
- Verzichten Sie auf Abkürzungen und Metaphern. Vermeiden Sie Akronyme.
- Stellen Sie Zahlen, Größenordnungen, Uhrzeiten und das Datum leicht verständlich dar.
- Schwierig: Ich habe drei Bücher gekauft.
Besser: Ich habe 3 Bücher gekauft - Schwierig: Dienstag, der 13.10.2008
Besser: Dienstag, der 13. Oktober 2008 - Schwierig: 45% der Menschen
Besser: Fast die Hälfte der Menschen
- Schwierig: Ich habe drei Bücher gekauft.
- Benutzen Sie einfache Zeitformen wie Präsenz oder Perfekt.
Satzbau
- Formulieren Sie kurze Sätze mit etwa 8 bis 10 Wörtern pro Satz.
- Ein Satz sollte jeweils eine Information enthalten.
- Formulieren Sie die Sätze folgendermaßen: Subjekt – Verb – Objekt.
- Verwenden Sie aktive Sprache statt Passiv-Konstruktionen.
- Schwierig: Medikamente werden vom Arzt gegeben.
Besser: Der Arzt gibt Ihnen Medikamente.
- Schwierig: Medikamente werden vom Arzt gegeben.
- Drücken Sie Tätigkeiten mit Verben aus statt mit Nominalisierungen.
- Schwierig: Die Verschiebung des Termins ist notwendig.
Besser: Wir müssen den Termin verschieben. - Schwierig: Die Überprüfung der Dokumente dauert 2 Tage.
Besser: Wir überprüfen die Dokumente. Das dauert 2 Tage.
- Schwierig: Die Verschiebung des Termins ist notwendig.
- Vermeiden Sie den Genitiv.
- Schwierig: Die Farbe des Autos ist rot.
Besser: Die Farbe von dem Auto ist rot.
- Schwierig: Die Farbe des Autos ist rot.
- Verwenden Sie positive Formulierung statt Verneinungen.
- Schwierig: Nicht vergessen, die Unterlagen mitzunehmen.
Besser: Bitte nehmen Sie die Unterlagen mit.
- Schwierig: Nicht vergessen, die Unterlagen mitzunehmen.
Textaufbau
- Setzen Sie alle Informationen in eine logische Reihenfolge.
- Achten Sie auf eine klare Struktur: Gliedern Sie den Text übersichtlich durch Absätze und Zwischenüberschriften.
- Verwenden Sie Bilder und/oder Piktogramme, die das Verständnis unterstützen.
Layout
- Verwenden Sie serifenlose Schriften.
- Verwenden Sie eine gut lesbare Schriftgröße und einen angepassten Zeilenabstand (1,5).
- Beginnen Sie jeden Satz in einer neuen Zeile.
- Setzen Sie den Text linksbündig.
- Setzen Sie Hervorhebungen wie Fettdruck oder Farben sparsam ein.
- Vermeiden Sie Sonderzeichen wie &, >, \, §.
Leichte Sprache kann als Text oder als gesprochene Sprache produziert werden. Leichte Sprache kommt allerdings häufiger schriftlich vor als mündlich. Das liegt an ihrem strikten Regelwerk. Es ist nur eingeschränkt möglich, sich spontan zu äußern und dabei strikte Regeln zu Wortschatz und Satzstruktur zu befolgen. Wenn Leichte Sprache mündlich verwendet wird, basiert das Gesprochene meist auf einem Skript, das im Vorfeld erstellt wurde.
Wie werden Texte in Leichter Sprache erstellt?
Texte in Leichter Sprache werden von unterschiedlichen Personen- und Berufsgruppen verfasst. Idealerweise sollten die Verfassenden sowohl in Sprache, Übersetzung und Texterstellung als auch spezifisch in Leichter Sprache qualifiziert sein. In Luxemburg ermöglichen entsprechende Fortbildungen allen Interessierten, diese Kompetenz zu erwerben.
Um das Verstehen von Texten in Leichter Sprache auf Nutzerseite zu gewährleisten, wird eine Prüfung des jeweiligen Textes durch eine Prüfgruppe empfohlen. Eine Prüfgruppe besteht aus Personen mit Lernschwierigkeiten, die auf Texte in Leichter Sprache angewiesen sind. So wird sichergestellt, dass der Text inhaltlich leicht verständlich ist und eine große Zielgruppe erreicht. Ein geprüfter Text in Leichter Sprache kann mit dem Logo von Inclusion Europe für Leichte Sprache versehen werden. Dieses Logo hat einen großen Wiedererkennungswert und macht die Texte leichter auffindbar.
Kann eine Prüfung durch eine Prüfgruppe nicht stattfinden, sollten Texte dennoch in Leichter Sprache verfasst werden. So wird der größtmögliche Zugang zu Informationen gewährleistet.
Gut zu wissen
Der Dienst Klaro von der APEMH bietet Beratung und Fortbildungen in Leichter Sprache an.
Op der Schock übersetzt Texte in Leichte Sprache, vor allem im Bereich Tourismus.
In Luxemburg gibt es derzeit folgende Prüfgruppen für Leichte Sprache:
- Das Atelier isie von der APEMH (Prüfung von Texten in Deutsch, Französisch und Englisch), und
- Die Prüfgruppe Op der Schock, die sich auf den Bereich Tourismus spezialisiert hat.
Das Centre pour le développement intellectuel (CC-CDI) hat einen Service Leichte Sprache. Dort werden Texte in Leichte Sprache ausschließlich für den schulischen Bereich übersetzt und geprüft.