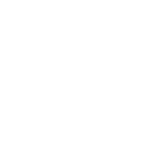In diesem Text erfahren Sie:
- Was ist Unterstützte Kommunikation?
- Welche Formen der Unterstützten Kommunikation gibt es?
- Warum ist Unterstützte Kommunikation wichtig?
Was ist Unterstützte Kommunikation (UK)?
Manche Menschen können nicht oder nur eingeschränkt sprechen. Gründe hierfür können sein: eine angeborene Behinderung, eine Krankheit oder ein Unfall. In einigen Fällen ist die Lautsprache nicht vorhanden oder nur wenig entwickelt. Hat eine Person zusätzlich eine körperliche Beeinträchtigung, können oftmals manuelle Ausdrucksformen nicht genutzt werden.
Unterstützte Kommunikation hilft diesen Menschen dabei, sich auszudrücken und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Unterstützte Kommunikation ersetzt vorhandene Fähigkeiten nicht, sondern ergänzt und verstärkt sie. Je nach Situation können unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert werden. Ziel ist es, die Verständigung im Alltag zu erleichtern und zu verbessern.
Welche Formen der Unterstützten Kommunikation gibt es?
Bei der UK wird zwischen körpereigenen und externen Kommunikationsformen unterschieden. Die externen Kommunikationsformen können Gegenstände oder elektronische Hilfsmittel sein.
Körpereigene Kommunikationsformen
Körpereigene Kommunikationsformen nutzen nur den eigenen Körper ohne zusätzliche Hilfsmittel. Hierzu gehören:
- Lautsprache und Laute
- Nonverbale Ausdrucksweisen wie Mimik, Gesten, Blicke, Zeigebewegungen, Körperspannung und Körperbewegungen (zum Beispiel Abwenden oder Zuwenden)
- Gebärden: Diese setzen eine sprachliche Grundlage voraus. Die Gebärden stammen entweder aus der Deutschen Gebärdensprache oder aus speziellen Gebärdensammlungen. Es gibt verschiedene Arten der Gebärdenkommunikation:
- Lautsprachunterstützende Gebärden: Wichtige Wörter werden zusätzlich zur Lautsprache gebärdet.
- Lautsprachbegleitendes Gebärden: Zu jedem einzelnen, gesprochenen Wort wird synchron gebärdet.
- Taktiles Gebärden: Der Sender der Information gebärdet. Der Empfänger der Information ertastet die Gebärden.
Nicht-elektronische Hilfsmittel
Nicht-elektronische Kommunikationshilfen sind Gegenstände, die die Verständigung unterstützen, wie zum Beispiel:
- Kommunikationstafeln und Kommunikationsordner: Übersichtliche Sammlungen von grafischen Symbolen
- Grafische Symbole: Fotos, Zeichnungen, Piktogramme, Schriftzeichen
- Kommunikationshefte: Ich-Bücher, Tagebücher, Kalender mit wichtigen persönlichen Informationen.
Grafische Symbole können einzeln genutzt werden oder auf Tafeln oder in Büchern fest angeordnet sein. Durch das Zeigen auf Symbole lassen sich ganze Sätze bilden. Das Zeigen kann mit dem Finger, den Augen oder speziellen Hilfsmitteln erfolgen.
Einfache elektronische Hilfsmittel
Sprechende Taster oder kleine Sprachhilfen mit Papierdeckblättern gehören zu den einfachen elektronischen Kommunikationsmitteln. Sie können direkt (zum Beispiel durch Zeigen) oder indirekt (z.B. über Scanning-Verfahren mit speziellen Sensoren) bedient werden.
Komplexe elektronische Kommunikationshilfen
Sprachcomputer (Talker) sind komplexe elektronische Kommunikationshilfen. Sie wandeln Symbole, Buchstaben oder Wörter in gesprochene Sprache um.
Die Ansteuerung kann individuell angepasst werden:
- Spezielle Taster: Bedienung mit Fuß, Kopf oder Mund
- angepasste Computermäuse, Pointer, und Joysticks
- Augensteuerung: eine Kamera erfasst die Blickbewegungen.
Warum ist Unterstützte Kommunikation wichtig?
Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich mitzuteilen und in Kontakt zu treten. Ohne passende Kommunikationsmöglichkeiten ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stark eingeschränkt. Ein selbstbestimmtes Leben ist dann oft unmöglich.
Unterstützte Kommunikation schafft gleichberechtigte Kommunikationschancen und ermöglicht es Menschen, ihre individuellen Bedürfnisse und Gedanken auszudrücken. Dadurch wird Teilhabe möglich.